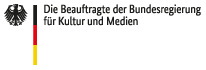und der lange Kampf um Anerkennung
an den Sinti und Roma und der
lange Kampf um Anerkennung
Die Anerkennung der Sinti und Roma als Verfolgte des Nationalsozialismus in Ostdeutschland
Nach dem Krieg lebten im Osten Deutschlands, der bis zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Oktober 1949 von der Sowjetunion verwaltet wurde, nur wenige Hundert Sinti und Roma. Viele Angehörige der Minderheit waren auf der Suche nach überlebenden Verwandten in den Westen Deutschlands gegangen.
In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR orientierten sich die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus und die Gewährung von Entschädigung vor allem an der aktiven Beteiligung am Widerstand gegen das NS-Regime. Der Krieg gegen die Sowjetunion galt als das größte Verbrechen Hitlerdeutschlands, die kommunistischen Widerstandskämpfer wurden zu Helden stilisiert. Als „Opfer des Faschismus“ erhielten sie Pensionen und weitere Privilegien. Keine Zuwendungen erhielten zunächst diejenigen Opfer der NS-Diktatur, denen unterstellt wurde, nicht aktiv gekämpft zu haben. Zu ihnen zählten auch Sinti und Roma sowie Juden.
Die Einführung einer erweiterten Entschädigungsmöglichkeit für die so genannten „Opfer der Nürnberger Gesetze“ im Oktober 1945 eröffnete auch den aus rassischen Gründen Verfolgten den Erhalt von Zuwendungen. Dies bezog sich jedoch ausschließlich auf Juden. Jüdische Organisationen indes unterstützten aufgrund der gemeinsamen Verfolgungserfahrung auch Sinti und Roma bei ihren Bemühungen um Entschädigung.
Im Mai 1946 wurden Änderungen in der Anerkennungspraxis von „Zigeunern“ in der SBZ verfügt, die verfolgten Sinti und Roma Anträge auf Entschädigung ermöglichten. Die Verfahren waren allerdings mit einer Reihe von Auflagen verknüpft, die eindeutig antiziganistische Züge trugen: Sinti und Roma mussten, um als „Opfer des Faschismus“ anerkannt zu werden, einen festen Wohnsitz und eine feste Beschäftigung nachweisen. Zudem galten die „Opfer des Faschismus“ als gesellschaftliche Vorbilder und von ihnen wurde ein Verhalten im Sinne der sozialistischen Staatsideologie eingefordert. Es kam vor, dass Sinti und Roma aufgrund der Unterstellung, nicht ausreichend am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft mitzuwirken, ihre Anerkennung als „Opfer des Faschismus“ und damit verbundene Zuwendungen verloren.
Die Erinnerungskultur in der DDR war durch den „antifaschistischen Kampf“ bestimmt, der als Legitimation des neuen Staates diente und eine zentrale Rolle im öffentlichen Gedenken einnahm. Der nationalsozialistische Völkermord an den Juden wurde als ein Verbrechen neben den vielen anderen des „Dritten Reiches“ marginalisiert. Der Völkermord an den Sinti und Roma hingegen wurde „vergessen“, wie es Mitte der 1960er Jahre eine Sintiza in einem Brief an die Zeitschrift „Wochenpost“ ausdrückte: „Aber keiner denkt daran, dass auch wir bittre Not gelitten haben, dass sich die Erde von Auschwitz und anderen Lagern rot von unserem Blut färbte. Warum hat man uns nur vergessen?“
Erst im Herbst 1986 wurde auf dem Friedhof des Berliner Stadtteils Marzahn, unweit des Geländes des ehemaligen Zwangslagers für Sinti und Roma, ein Gedenkstein für die ermordeten Angehörigen der Minderheit eingeweiht. Dieser erste Gedenkort für Sinti und Roma in der DDR ging auf das langjährige Engagement des Bürgerrechtlers Reimar Gilsenbach zurück. Ein zweites von Gilsenbach initiiertes Denkmal für die Opfer der Sinti und Roma in Magdeburg wurde erst nach dem Fall der Mauer, Ende Oktober 1998, realisiert. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Magdeburger Dom.